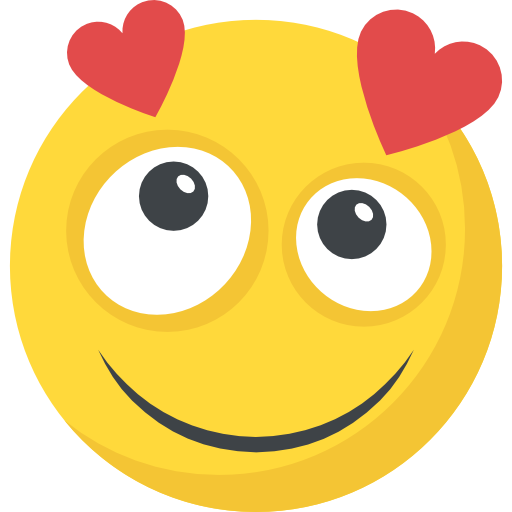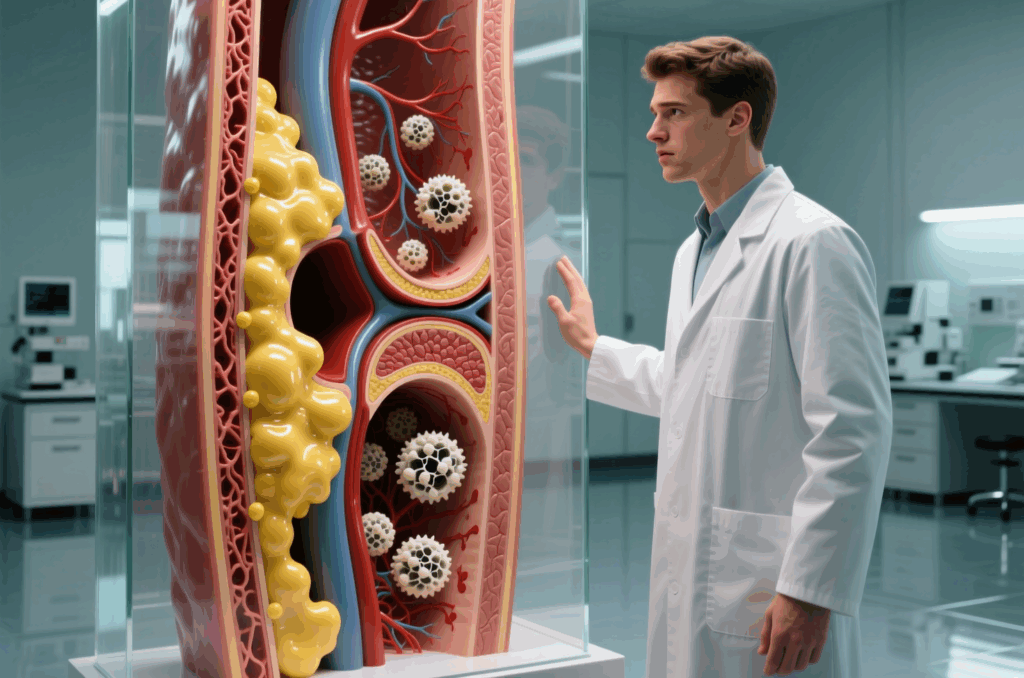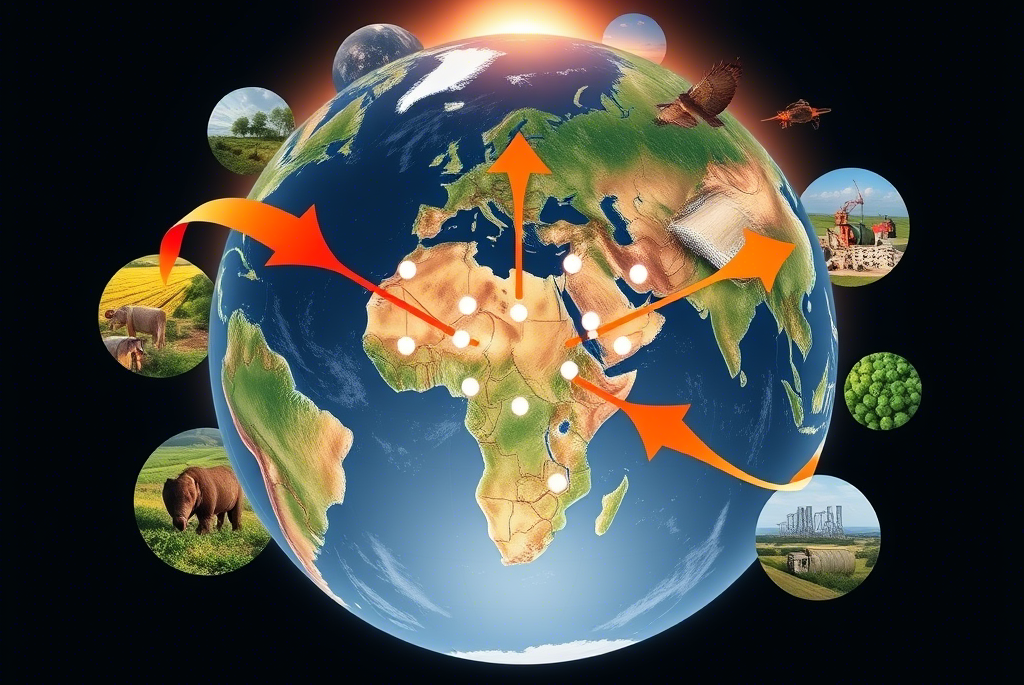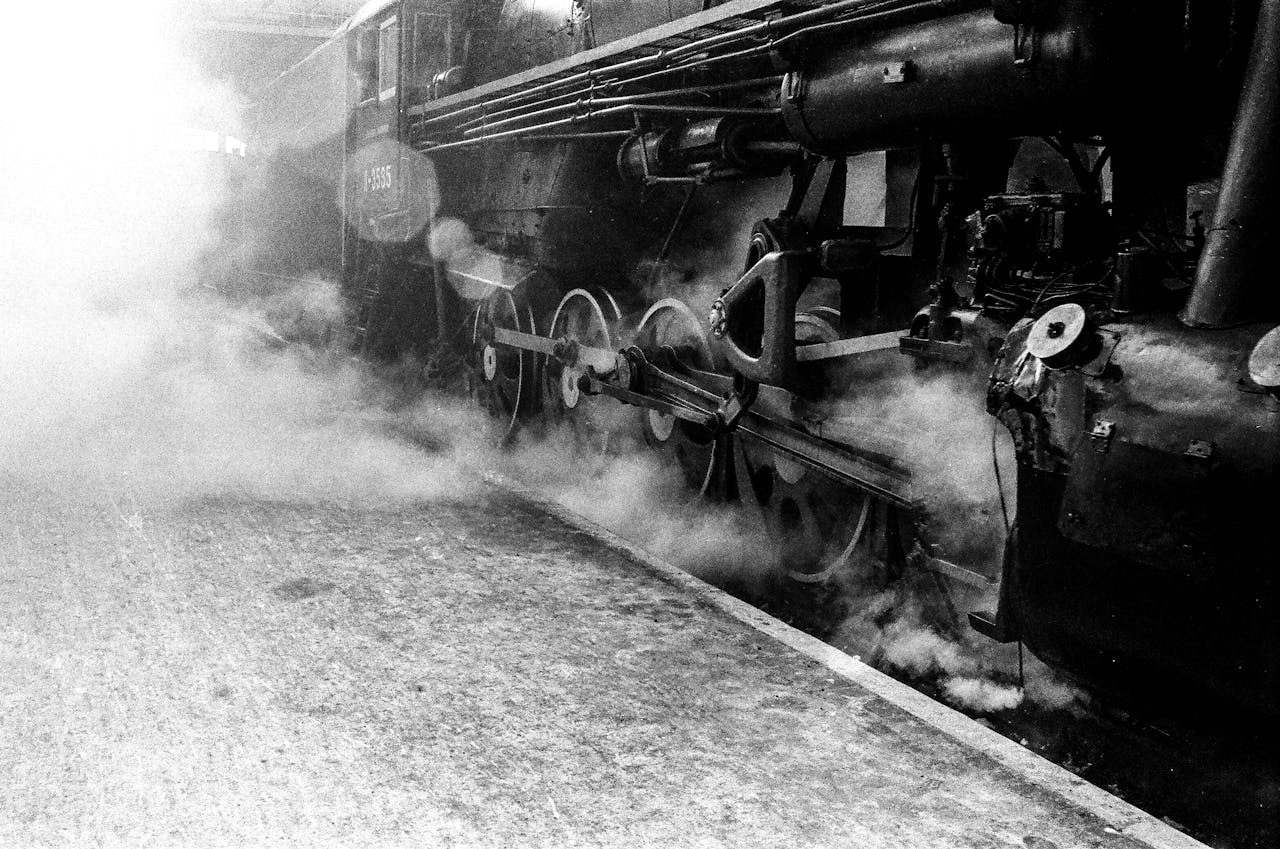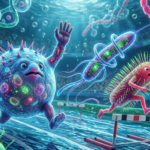Now Reading: Was ist das für ein Geruch und woher wissen Sie das?
-
01
Was ist das für ein Geruch und woher wissen Sie das?
Was ist das für ein Geruch und woher wissen Sie das?

Es ist klar, dass Gene, Rezeptoren und Neuronen bei der Geruchserkennung eine Rolle spielen. Doch wie wir das, was wir riechen, interpretieren, bleibt größtenteils rätselhaft. Ein Neurowissenschaftler erklärt.
Von Daniela Hirschfeld 09.04.2024
Peter Mombaerts ist ein Mann mit starken Vorlieben. Er trinkt gern belgisches Bier – teilweise, aber nicht ausschließlich aus patriotischen Gründen. Er mag klassische Musik und beobachtet die Erde gerne von oben, während er mit seiner Amateurpilotenlizenz kleine Flugzeuge fliegt. Im Winter liebt er das Gefühl von Alpaka-Kleidung.
Doch Mombaerts, Leiter der Max-Planck-Forschungsstelle für Neurogenetik in Frankfurt, sagt, er habe keinen Lieblingsgeruch – obwohl er sich seit über 30 Jahren mit der Erforschung von Gerüchen beschäftigt.
Mombaerts’ Forschung konzentrierte sich auf die Verarbeitung von Gerüchen im Gehirn und auf die beeindruckende Gruppe von Genen, die Geruchsrezeptoren bei Säugetieren kodieren. Der Mensch besitzt etwa 400 dieser Gene, was bedeutet, dass zwei Prozent unserer rund 20.000 Gene uns beim Riechen helfen – die größte bisher bekannte Genfamilie , wie Mombaerts bereits 2001 im Annual Review of Genomics and Human Genetics feststellte . Mehr als zwei Jahrzehnte später ist sie immer noch Rekordhalter, und Mombaerts erforscht weiterhin die Genetik und Neurowissenschaft der Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum riechen.
Er sprach mit dem Knowable Magazine über die Erkenntnisse über die Gene, Rezeptoren und Neuronen, die an der Geruchswahrnehmung beteiligt sind – und die noch offenen Rätsel. Dieses Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit gekürzt.
Warum haben Sie angefangen, sich mit Gerüchen zu beschäftigen?
Während meines Medizinstudiums in meiner Heimat Belgien in den 1980er Jahren stellte ich fest, dass ich nicht so gern mit Patienten arbeite. Doch die Forschung reizte mich. Ich wollte Neurobiologie studieren. Ich promovierte in Immunologie mit Mäusen und Genetik und wechselte dann zur Neurowissenschaft. Das war schon immer mein Traum, aber ich musste das richtige Thema, das richtige Labor und den richtigen Mentor finden – und all das kam zusammen, als Linda Buck und Richard Axel ihre Arbeit über die Entdeckung der Gene für Geruchsrezeptoren veröffentlichten.
Dieser Artikel erschien am 5. April 1991 in der Zeitschrift Cell , und als ich die ersten Sätze las, dachte ich: „Daran möchte ich arbeiten.“ Axel wurde mein Postdoc-Mentor. Als Buck und Axel 2004 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielten, schrieb ich einen Perspektivartikel für das New England Journal of Medicine mit dem Titel „ Liebe auf den ersten Geruch “.
Wie funktioniert der Geruchssinn?
Landsäugetiere wie der Mensch nehmen flüchtige Gerüche wahr, die über die Luft aufgenommen werden. Die vielen chemischen Bestandteile eines Geruchs verteilen sich in der Schleimschicht unserer Nase und interagieren mit Geruchsrezeptoren in den Riechnerven. Jeder Geruchsstoff interagiert mit mehreren Rezeptoren, und umgekehrt interagiert jeder Geruchsrezeptor mit mehreren Geruchsstoffen. Diese Nervenzellen erzeugen elektrische Signale, die an den Riechkolben des Gehirns weitergeleitet, dort verarbeitet und an den Riechkortex, den für den Geruchssinn zuständigen Bereich der Großhirnrinde, weitergeleitet werden.
Das ist es im Wesentlichen. Aber wie genau wir Bananen als Bananen erkennen, wissen wir noch immer nicht. Das ist eine der großen ungelösten Fragen.
Warum verstehen wir es noch nicht?
Ich bin seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig, und es ist eine sehr einfache Frage mit einer schwierigen Antwort. Viele chemische Verbindungen erzeugen zusammen den Geruch einer Banane. Die genaue Zusammensetzung und die relativen Anteile variieren von Banane zu Banane – und dennoch erkennen wir sie alle als Bananen. Man kann den Geruch einer Banane mit Molekülen nachahmen, die in einer Banane gar nicht vorkommen. Wir kennen die Komponenten des olfaktorischen Systems – die Geruchsrezeptoren, die olfaktorischen sensorischen Neuronen, die Regionen des Nervensystems –, die uns dies ermöglichen. Aber wie genau das funktioniert, verstehen wir noch nicht.
Wie untersuchen Forscher das olfaktorische System?
Die ersten Geruchsrezeptorgene wurden von Buck und Axel an Ratten entdeckt. Wegen der Möglichkeit genetischer Manipulation konzentrierte sich das Forschungsgebiet bald auf Mäuse. Fast alles, was wir über den Geruchssinn wissen – molekularbiologische, histologische, physiologische und anatomische Erkenntnisse – basiert auf Studien an Mäusen – genauer gesagt an genetisch manipulierten Mäusen.
Ich bin jedoch der Meinung, dass sich die Geruchssysteme von Mäusen und Menschen möglicherweise so stark unterscheiden, dass die Frage aufgeworfen wird, wie viel wir durch Extrapolation von Mäusen über den menschlichen Geruchssinn lernen können.
Arten unterscheiden sich erheblich in der Anzahl ihrer Geruchsrezeptorgene. Afrikanische Elefanten beispielsweise besitzen mit rund 2.000 die größte Anzahl an Geruchsrezeptorgenen – fast doppelt so viele wie Mäuse und Hunde und fünfmal so viele wie Menschen. Sind sie deshalb bessere Riecher?
Die enorme Größe des Geruchsrezeptor-Genrepertoires ist eine der verblüffenden Entdeckungen der bahnbrechenden Arbeit von Buck und Axel aus dem Jahr 1991. Es besteht jedoch kein einfacher Zusammenhang zwischen der Anzahl der Gene, die Geruchsrezeptoren kodieren, und der Leistungsfähigkeit des olfaktorischen Systems einer Art. Da die Geruchsrezeptor-Gene so klein sind, scheinen Arten ihr Repertoire im Laufe der Evolution relativ schnell erweitern oder reduzieren zu können, um auf veränderte Bedürfnisse zu reagieren.
Da so viele Gene am Geruchssinn beteiligt sind, kann man dann sagen, dass ein guter Geruchssinn eine vererbbare Eigenschaft ist?
Ich kenne keine stichhaltigen Beweise dafür, dass ein „guter“ Geruchssinn eine genetische Grundlage hat, aber wahrscheinlich ist es so. Angesichts von 400 Geruchsrezeptorgenen ist diese Frage tatsächlich schwer zu untersuchen.
Es gibt Menschen, die einen sehr guten Geruchssinn haben. In der Parfümindustrie nennt man sie auf Französisch „ nez“ , eine Nase. Sie sind keine „Superriecher“; sie trainieren täglich. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass dies eine genetische Ursache hat.
Ein kleiner Prozentsatz der Menschen wird mit angeborener Anosmie geboren, also ohne funktionierenden Geruchssinn. In einem Teil dieser Fälle ist die genetische Ursache bekannt – wie beispielsweise beim Kallmann-Syndrom –, häufiger jedoch nicht.
Überraschenderweise haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Geruchsrezeptorgene nicht nur in der Nase, sondern auch anderswo im Körper aktiv sind. Bedeutet das, dass diese Gene mehr können, als nur Gerüche wahrzunehmen?
Offenbar ja. Ich habe an einem Rezeptor namens Olfr78 gearbeitet , der in verschiedenen Körpergeweben außerhalb der Nase exprimiert wird, beispielsweise in der Prostata, in Melanozyten und im Glomus caroticum, das die Atmung reguliert. Kürzlich berichteten Kollegen aus Sevilla, Spanien, und ich, dass Olfr78 für die Reifung der Zellen im Glomus caroticum erforderlich ist, die einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut erkennen. Wie genau Olfr78 das macht, ist noch unklar.
Haben diese Erkenntnisse Auswirkungen auf die Medizin oder Therapie?
Derzeit kenne ich keine medizinische Therapieanwendung, möglicherweise aufgrund der Komplexität des Geruchssinns. Irgendwann werden kluge Wissenschaftler oder innovative Unternehmen eine Therapieanwendung entwickeln. Im Moment ist es Grundlagenforschung, die Neugier befriedigt und Gene, Rezeptoren und die Evolution untersucht, ohne direkt zu wissen, ob wir diese oder jene Krankheit heilen können.
Sie haben auch den durch SARS-CoV-2 verursachten Verlust des Geruchssinns untersucht und die Möglichkeit, dass das olfaktorische System dem Virus einen Weg ins Gehirn bietet. Was haben Sie herausgefunden?
Besondere Bedenken bestanden hinsichtlich der Frage, ob das Virus über den Geruchssinn ins Gehirn eindringen könnte. Die Riechkolben befinden sich nur wenige Millimeter von der Riechschleimhaut in der Nase entfernt, getrennt durch ein dünnes Stück perforierten Schädelknochens, durch das die Fortsätze (Axone) der olfaktorischen sensorischen Neuronen verlaufen. Das Virus könnte also prinzipiell über den Geruchssinn in die Schädelhöhle gelangen und möglicherweise zur Entstehung von Long Covid, insbesondere Neuro-Covid, beitragen.
Es gab einige erste, eher kurz und knapp verfasste Arbeiten, die behaupteten, SARS-CoV-2 könne menschliche Riechnervenzellen infizieren. Von 2020 bis 2022 führten wir in meiner belgischen Heimatstadt Leuven eine große Studie durch. Dabei untersuchten wir Gewebeproben von 115 Patienten, die kurz nach der Diagnose an oder mit Covid-19 gestorben waren.
Wir haben intensiv nach Hinweisen auf eine Infektion der Riechnerven, des Bulbus olfactorius und des Gehirns gesucht. Und wir konnten keine finden. Ich glaube, die Fachwelt geht mittlerweile davon aus, dass SARS-CoV-2 tatsächlich keine Riechnerven beim Menschen infiziert. Aber – auf Englisch klingt das sehr nett – das Fehlen von Beweisen ist nicht gleichbedeutend mit dem Beweis des Fehlens, oder? In der Wissenschaft kann man eine Verneinung nicht beweisen.
Wenn SARS-CoV-2 die olfaktorischen Sinnesneuronen nicht infiziert, warum verlieren Menschen mit Covid dann oft ihren Geruchssinn?
Zellen, die sogenannten Sustentakelzellen oder Stützzellen, umgeben die Riechnerven im Riechepithel und unterstützen sie auf eine noch wenig verstandene Weise. Wir haben gezeigt, dass diese unbesungenen Helden mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Man kann sich also leicht vorstellen, dass bei einer Infektion der Stützzellen auch die von ihnen unterstützten Riechnerven betroffen sind: Sie funktionieren zumindest vorübergehend nicht mehr normal. Wie genau es jedoch von der Infektion der Sustentakelzellen zum Verlust des Geruchssinns kommt, ist noch nicht verstanden. Die Zusammenhänge müssen noch geklärt werden.
Was mich – wenn ich dieses Wort verwenden darf – fasziniert, ist, dass der Verlust des Geruchssinns bei Covid-19-Patienten sehr plötzlich auftreten kann. Normalerweise erleben sie ihn morgens, manchmal innerhalb weniger Stunden. Und dann erholt er sich meist innerhalb weniger Wochen. Dieser abrupte Beginn der Symptome lässt mich vermuten, dass wir den Mechanismus falsch betrachtet haben. Vielleicht ist es nicht so wichtig, was in der Riechschleimhaut passiert, aber vielleicht passiert etwas im Riechkolben oder anderswo im Gehirn – vielleicht ein Gefäßproblem –, das einen plötzlichen Verlust des Geruchssinns verursacht.
Ist das noch wichtig?
Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Notstandsphase für beendet erklärt, doch viele Menschen infizieren sich weiterhin, und viele verlieren weiterhin ihren Geruchssinn. Die Menschen haben sich so sehr daran gewöhnt, dass es für die Mainstream-Medien keine Neuigkeit mehr ist. Etwa jeder zwanzigste bis zehnte Mensch, der im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion seinen Geruchssinn verliert, erlangt ihn nicht zurück, zumindest nicht für die Dauer der Pandemie. Es sieht so aus, als ob die Geruchsstörung, wenn sie nach acht Wochen nicht zurückgekehrt ist, noch lange und möglicherweise sogar ein Leben lang anhalten könnte – wer weiß?
Weltweit leiden mittlerweile Millionen, vielleicht sogar Zehnmillionen Menschen an einer chronischen Geruchsstörung im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Wir in der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft sollten weiterhin daran arbeiten, den Mechanismus zu verstehen, damit eine rationale Heilung entwickelt werden kann. Auch wenn ein beeinträchtigter oder verzerrter Geruchssinn weder zum Tod führt noch das Gehirn direkt beeinträchtigt, kann er die Lebensqualität drastisch beeinträchtigen.
Würden Sie angesichts der vielen grundlegenden Erkenntnisse der Wissenschaft über den Geruchssinn sagen, dass die Erforschung des Geruchssystems hinter der Erforschung anderer Sinne zurückliegt?
Ja, ich denke schon. Zusammen mit dem Geschmackssinn – beides chemische Sinne – war es der letzte, der in die Mainstream-Neurowissenschaft aufgenommen wurde. Für mich umfasst das Gebiet des Geruchssinns zwei Epochen: vor und nach Buck und Axel im Jahr 1991. Es ist ein sehr, sehr großes Feld geworden, an dem viele Labore arbeiten. Wir haben gerade eine globale Konferenz in Reykjavik, Island, mit 725 Teilnehmern aus 30 Ländern abgeschlossen, die sich mit den chemischen Sinnen beschäftigten.
Bleiben Sie auf dem Laufenden.
Melden Sie sich noch heute für den Knowable Magazine- Newsletter an.
Welche Fragen interessieren Sie nach 30 Jahren in diesem Bereich heute?
Sie sind eigentlich dieselben wie damals, als ich 1993 als Postdoc bei Richard Axel in das Forschungsfeld einstieg. Sie sind leicht zu formulieren, aber nicht leicht zu beantworten. Eine davon ist die Bananenfrage: Warum riecht eine Banane wie eine Banane? Bananen strahlen typischerweise Hunderte von Verbindungen aus, aber unser Gehirn sagt: „Okay, das riecht wie eine Banane.“
Eine weitere Frage ist, wie Geruchsrezeptorgene aktiviert werden. Ein ausgereiftes Riechneuron nutzt nur eines dieser Gene. Wie wählt ein Riechneuron dann eines dieser 1.141 Gene einer Maus zur Aktivierung aus? Das ist eine sehr interessante Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt.
Die dritte Frage betrifft die sogenannte axonale Verdrahtung . Als Postdoc habe ich gezeigt, dass bei Mäusen alle olfaktorischen Neuronen, die ein bestimmtes Geruchsrezeptorgen exprimieren, ihre Axone an eine oder wenige spezifische Regionen im Riechkolben, die sogenannten Glomeruli, senden. Der Riechkolben einer Maus enthält mehrere tausend Glomeruli. Wie diese Axone ein gemeinsames Ziel im Riechkolben finden, bleibt ein Rätsel und fasziniert mich weiterhin.
Foto: Cottonbro Studio auf Pexels