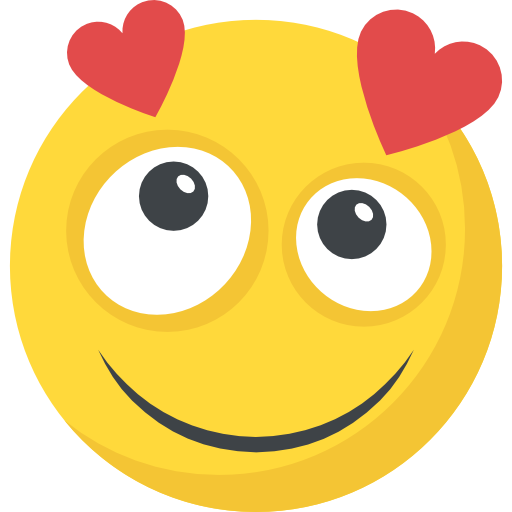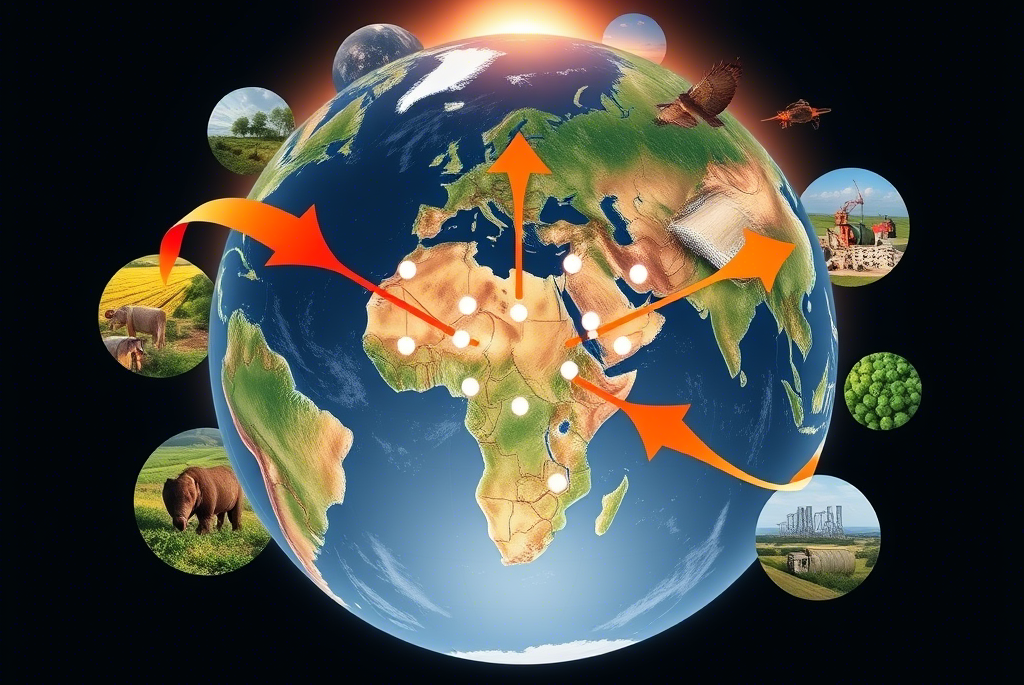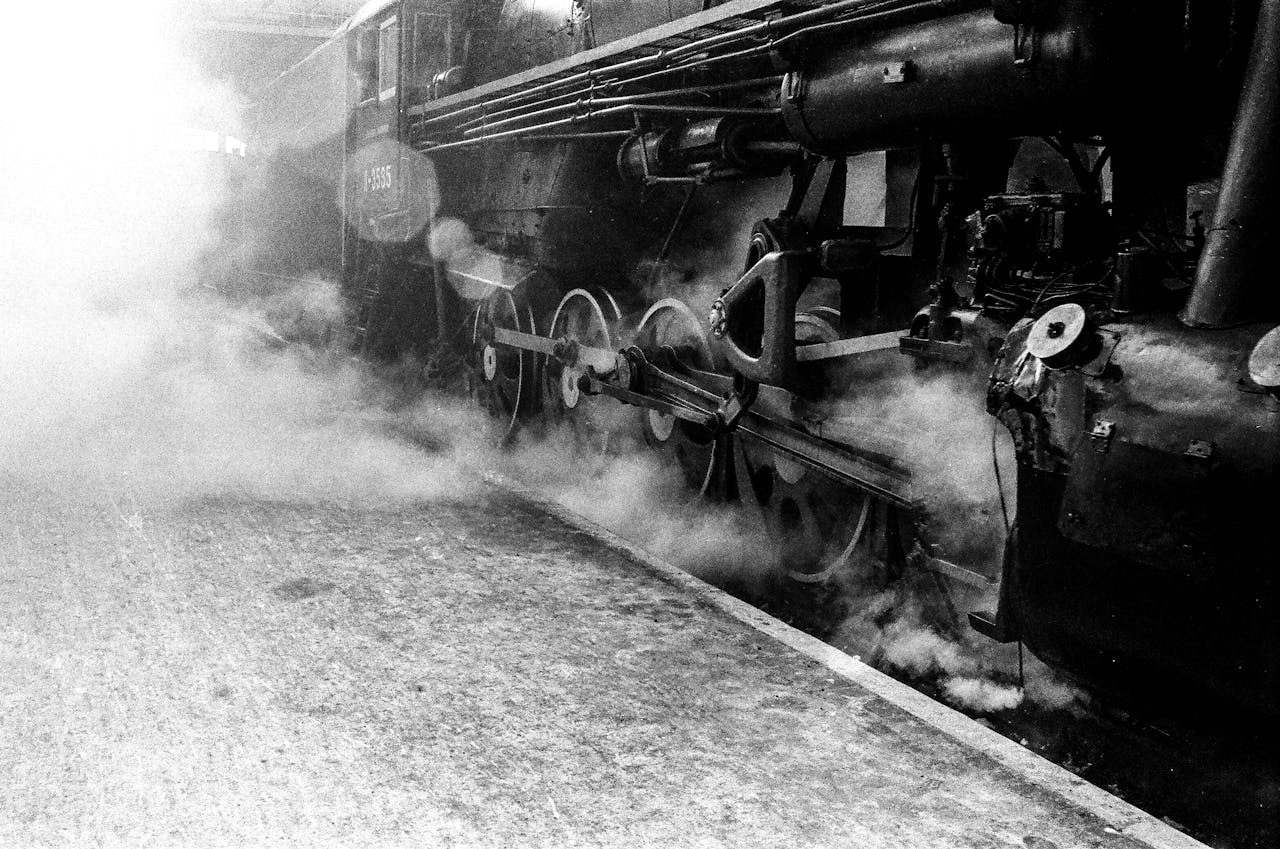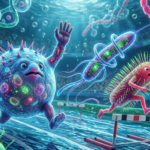Now Reading: Nachhaltiges Bauen erreicht mit Wolkenkratzern aus Holz neue Höhen
-
01
Nachhaltiges Bauen erreicht mit Wolkenkratzern aus Holz neue Höhen
Nachhaltiges Bauen erreicht mit Wolkenkratzern aus Holz neue Höhen

Auf Festigkeit und Sicherheit ausgelegtes Holz bietet Architekten eine Alternative zu kohlenstoffintensivem Stahl und Beton
Von Kurt Kleiner 10.08.2024
An der Universität von Toronto, direkt gegenüber dem Fußballstadion, errichten Arbeiter ein 14-stöckiges Gebäude mit Platz für Klassenzimmer und Dozentenbüros. Ungewöhnlich ist die Bauweise: Sie verschrauben riesige Balken, Säulen und Platten aus vorgefertigten Holzplatten.
Jedes Holzelement wird per Pritsche angeliefert und von einem hohen Kran an seinen Platz gehoben und fixiert, während die Arbeiter es mit Metallverbindern befestigen. Im halbfertigen Zustand ähnelt das Gebäude einem Möbelstück im Aufbau.
Der Turm nutzt eine neue Technologie namens Massivholz. Bei dieser Bauweise ersetzen massive Holzelemente, die sich über mehr als die Hälfte eines Fußballfeldes erstrecken können, Stahlträger und Beton. Obwohl sie noch relativ selten ist, erfreut sie sich wachsender Beliebtheit und taucht in Skylines weltweit auf.
Das höchste Massivholzgebäude ist heute der 25-stöckige Ascent-Wolkenkratzer in Milwaukee, der 2022 fertiggestellt wurde. Weltweit waren zu diesem Zeitpunkt 84 Massivholzgebäude mit acht oder mehr Stockwerken bereits fertiggestellt oder im Bau, weitere 55 waren geplant. Laut einem Bericht des Council on Tall Buildings and Urban Habitat befanden sich 70 Prozent der bestehenden und künftigen Gebäude in Europa, etwa 20 Prozent in Nordamerika und der Rest in Australien und Asien. Zählt man kleinere Gebäude hinzu, waren bis 2023 allein in den USA mindestens 1.700 Massivholzgebäude errichtet.
Massivholz ist eine attraktive Alternative zu energieintensivem Beton und Stahl, die zusammen für fast 15 Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich sind. Obwohl Experten noch immer über die Rolle von Massivholz im Kampf gegen den Klimawandel diskutieren, sind viele überzeugt, dass es umweltfreundlicher ist als herkömmliche Baumethoden. Schließlich basiert es auf Holz, einem nachwachsenden Rohstoff.
Massivholz bietet zudem eine besondere Ästhetik, die einem Gebäude eine besondere Note verleihen kann. „Die Leute haben Stahl und Beton satt“, sagt Ted Kesik, Bauwissenschaftler am Mass Timber Institute der Universität Toronto, das Forschung und Entwicklung im Bereich Massivholz fördert. Mit seiner warmen, beruhigenden Ausstrahlung und den natürlichen Variationen kann Holz optisch ansprechender sein. „Die Leute sehen Holz tatsächlich gerne an.“
Gleiches Holz, stärkere Struktur
Die Verwendung von Holz für große Gebäude ist natürlich nichts Neues. Die Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert führte zu einer Nachfrage nach großen Fabriken und Lagerhallen, die oft in Ziegel- und Balkenbauweise errichtet wurden – einem Rahmen aus schweren Holzbalken, der die äußeren Ziegelwände stützt.
Als die Gebäude jedoch immer höher wurden, griffen die Bauherren auf Beton und Stahl als Stützen zurück. Der Holzbau beschränkte sich hauptsächlich auf Häuser und andere kleine Gebäude aus dem standardisierten Bauholz, das man bei Home Depot stapeln sieht.
Doch vor etwa 30 Jahren begannen Bauarbeiter in Deutschland und Österreich mit Techniken zur Herstellung massiver Holzelemente aus diesem leicht verfügbaren Holz zu experimentieren. Sie verwendeten Nägel, Dübel und Leim, um kleinere Holzstücke zu großen, stabilen und soliden Massen zu verbinden, für die kein Fällen großer, alter Bäume erforderlich war.
Ingenieure wie der in der Schweiz lebende deutsche Ingenieur Julius Natterer leisteten Pionierarbeit für neue Baumethoden mit diesen Materialien. Und Architekten wie der Österreicher Hermann Kaufmann erregten mit Massivholzprojekten Aufmerksamkeit, darunter die 1997 fertiggestellten Ölzbündt-Apartments in Österreich und Brock Commons, ein 18-stöckiges Studentenwohnheim an der University of British Columbia, das 2017 fertiggestellt wurde.
Im Prinzip ähnelt Massivholz Sperrholz, nur in viel größerem Maßstab: Die kleineren Stücke werden in großen Spezialpressen unter Druck geschichtet und zusammengeklebt. Heute können bis zu 50 Meter lange Balken, meist aus Brettschichtholz (BSH), Stahlelemente ersetzen. Bis zu 50 Zentimeter dicke Platten, typischerweise aus Brettsperrholz (CLT), ersetzen Beton für Wände und Böden.
Diese Holzverbundstoffe können überraschend stabil sein – gewichtsmäßig sogar stärker als Stahl. Um diese Festigkeit zu erreichen, muss ein Massivholzelement jedoch massiver sein. Je höher ein Gebäude wird, desto dicker müssen die Holzstützen werden; irgendwann nehmen sie einfach zu viel Platz ein. Daher greifen Architekten bei höheren Massivholzgebäuden, wie dem Ascent-Wolkenkratzer, oft auf eine Kombination aus Holz, Stahl und Beton zurück.
Historisch betrachtet war der Brandschutz eine der größten Bedenken bei der Verwendung von Massivholz für hohe Gebäude. Bis vor Kurzem beschränkten viele Bauvorschriften den Holzbau auf niedrige Gebäude.
Obwohl sie nicht vollständig feuerfest sein müssen, müssen Gebäude dem Einsturz lange genug standhalten, damit Feuerwehrleute die Flammen unter Kontrolle bringen und die Bewohner ins Freie gelangen können. Materialien, die beispielsweise in konventionellen Wolkenkratzern verwendet werden, müssen im Brandfall mindestens drei Stunden lang stabil bleiben.
Um die Feuerbeständigkeit von Massivholz zu demonstrieren, legen Ingenieure die Holzelemente in gasbefeuerte Kammern und überwachen ihre Integrität. Bei anderen Tests werden Attrappen von Massivholzgebäuden in Brand gesetzt und die Ergebnisse aufgezeichnet.
Diese Tests haben Aufsichtsbehörden und Kunden nach und nach davon überzeugt, dass Massivholz lange genug brennt, um brandsicher zu sein. Das liegt unter anderem daran, dass sich an der Außenseite des Holzes frühzeitig eine verkohlte Schicht bildet, die das Innere vor einem Großteil der Feuerhitze isoliert.
Massivholz erhielt 2021 eine wichtige Anerkennung, als der International Code Council den International Building Code, der als Vorbild für Gerichtsbarkeiten weltweit dient, änderte, um Massivholzbauten mit bis zu 18 Stockwerken zuzulassen. Mit dieser Änderung wird erwartet, dass immer mehr Gemeinden ihre Vorschriften aktualisieren, um hohe Massivholzgebäude routinemäßig zuzulassen, anstatt Sondergenehmigungen einzuholen.
Es gibt jedoch noch weitere Herausforderungen. „Feuchtigkeit ist das eigentliche Problem, nicht Feuer“, sagt Steffen Lehmann, Architekt und Wissenschaftler für urbane Nachhaltigkeit an der University of Nevada in Las Vegas.
In allen Gebäuden muss die Feuchtigkeit kontrolliert werden, besonders bei Massivholz ist dies entscheidend. Nasses Holz ist anfällig für Pilzbefall und Insekten wie Termiten. Bauherren achten sorgfältig darauf, dass das Holz während Transport und Bau nicht nass wird, und entwickeln einen umfassenden Feuchtigkeitsmanagementplan, der unter anderem Heiz- und Lüftungssysteme zur Vermeidung von Feuchtigkeitsansammlungen umfasst. Für zusätzlichen Schutz vor Insekten kann Holz mit chemischen Pestiziden behandelt oder im Bodenbereich mit Netzen oder anderen physischen Barrieren umgeben werden.
Ein weiteres Problem ist die Akustik, da Holz Schall sehr gut überträgt. Designer verwenden unter anderem Schalldämmmaterialien, lassen Platz zwischen den Wänden und bauen Doppelböden ein.
Potenzielle Vorteile von Massivholz
Um die globale Erwärmung zu bekämpfen, müssen die Treibhausgasemissionen des Bausektors reduziert werden, der weltweit für 39 Prozent der Emissionen verantwortlich ist. Diana Ürge-Vorsatz, Umweltwissenschaftlerin an der Central European University in Wien, sagt, dass Massivholz und andere biobasierte Materialien einen wichtigen Beitrag dazu leisten könnten.
In einem Artikel aus dem Jahr 2020 im Annual Review of Environment and Resources zitieren sie und ihre Kollegen eine Schätzung der Holzindustrie, wonach durch das 18-stöckige Brock Commons in British Columbia im Vergleich zu einem ähnlichen Gebäude aus Beton und Stahl 2.432 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden wurden . 679 Tonnen dieser Einsparungen resultieren aus der Tatsache, dass bei der Herstellung von Holz im Vergleich zu Beton und Stahl weniger Treibhausgasemissionen entstehen . Weitere 1.753 Tonnen CO₂- Äquivalent wurden im Holz des Gebäudes gebunden.
„Wenn wir biobasiertes Material verwenden, haben wir einen doppelten Gewinn“, sagt Ürge-Vorsatz.
Die aktuelle Begeisterung über die Klimavorteile von Massivholz beruht jedoch größtenteils auf gravierenden Annahmen. So wird beispielsweise oft davon ausgegangen, dass das in einem Massivholzgebäude verwendete Holz durch das Wachstum neuer Bäume ersetzt wird und diese im Laufe der Zeit die gleiche Menge CO2 aus der Atmosphäre binden. Werden alte Bäume jedoch durch neue Anpflanzungen ersetzt, könnten die neuen Bäume nie wieder die gleiche Größe erreichen wie die ursprünglichen Bäume, argumentieren einige Umweltgruppen. Zudem gibt es Bedenken, dass die steigende Nachfrage nach Holz zu mehr Abholzung und weniger Anbaufläche für die Nahrungsmittelproduktion führen könnte.
Studien gehen zudem davon aus, dass der Kohlenstoff im Holz, sobald es in einem Gebäude verbaut ist, dauerhaft gebunden ist. Doch nicht das gesamte Holz eines gefällten Baumes findet sich im Endprodukt wieder. Äste, Wurzeln und Sägewerksabfälle können verrotten oder verbrannt werden. Und wenn das Holz beim Abriss des Gebäudes auf einer Mülldeponie landet, kann der Kohlenstoff in Form von Methan und anderen Emissionen freigesetzt werden.
„Viele Architekten kratzen sich am Kopf“, sagt Stephanie Carlisle, Architektin und Umweltforscherin beim gemeinnützigen Carbon Leadership Forum , und fragt sich, ob Massivholz immer einen Nettonutzen hat. „Stimmt das?“ Sie glaubt, dass es durchaus Vorteile für das Klima gibt. Um das Ausmaß dieser Vorteile zu verstehen, sei jedoch weitere Forschung erforderlich, sagt sie.
Mittlerweile steht Massivholz an der Spitze eines völlig anderen Baumodells, dem sogenannten integrierten Design. Beim traditionellen Bauen entwirft zunächst ein Architekt ein Gebäude, und anschließend werden mehrere Firmen mit den verschiedenen Bauabschnitten beauftragt – von der Fundamentlegung über den Bau des Tragwerks bis hin zur Installation der Lüftungsanlage usw.
Bleiben Sie auf dem Laufenden.
Melden Sie sich noch heute für den Knowable Magazine- Newsletter an.
Beim integrierten Design, so Kesik, ist die Entwurfsphase deutlich detaillierter und bezieht die verschiedenen Firmen von Anfang an mit ein. Wie die verschiedenen Komponenten zusammenpassen und zusammenarbeiten, wird im Voraus festgelegt. Die genauen Größen und Formen der Elemente sind vorgegeben, und sogar Löcher für Befestigungspunkte können vorgebohrt werden. Das bedeutet, dass viele Komponenten außerhalb der Baustelle gefertigt werden können, oft mit modernen computergesteuerten Maschinen.
Viele Architekten schätzen diese Vorgehensweise, da sie dadurch mehr Kontrolle über die Bauelemente haben. Und weil so viel Arbeit im Voraus erledigt wird, können die Gebäude vor Ort in der Regel schneller errichtet werden – bis zu 40 Prozent schneller als andere Gebäude, sagt Lehmann.
Massivholzgebäude werden laut Kesik eher wie Autos hergestellt, wobei alle Einzelteile zur Montage an einen endgültigen Standort transportiert werden. „Wenn das Massivholzgebäude auf der Baustelle ankommt, wirkt es wie ein überdimensionales Ikea-Möbelstück“, sagt er. „Alles passt irgendwie zusammen.“
Foto nur Sybolbild: Nextvoyage auf Pexels