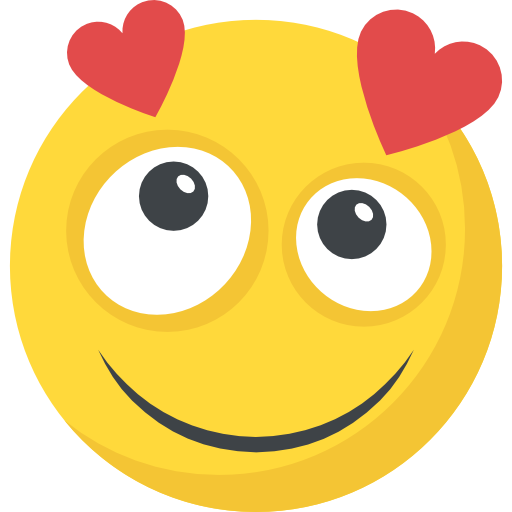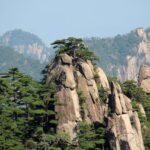Now Reading: Die Geheimnisse der Schmetterlingswanderung, geschrieben in Pollen
-
01
Die Geheimnisse der Schmetterlingswanderung, geschrieben in Pollen
Die Geheimnisse der Schmetterlingswanderung, geschrieben in Pollen

Billionen von Insekten bewegen sich jedes Jahr rund um den Globus. Wissenschaftler arbeiten an neuen Methoden, um diese Fernreisen zu kartieren.
Von Saugat Bolakhe 18.11.2024
An einem warmen Sommermorgen im belgischen Ieper betritt der 66-jährige Sylvain Cuvelier mit seiner 14-jährigen Enkelin seinen blühenden Garten, um die flatternden Schmetterlinge zu bestimmen und zu zählen. An anderen Tagen hilft er Wissenschaftlern, indem er Schmetterlingsproben einfängt. Anschließend erfasst er den Standort jeder Sichtung per GPS, trägt ihn in seine Excel-Datenbank ein und schickt die Proben manchmal an seine akademischen Kollegen, die die an den Insektenkörpern haftenden Pollenkörner analysieren.
Diese winzigen Pollenkörner, die von Bürgerwissenschaftlern wie Cuvelier gesammelt werden, helfen Forschern dabei, einen Prozess zu untersuchen, der bislang weitgehend unergründlich war: die Migrationsmuster von Insekten, die sich im Laufe mehrerer Generationen rund um den Globus bewegen.
Mithilfe von Pollen konnten Wissenschaftler den Ausgangspunkt einzelner Schmetterlinge bestimmen und sogar Rückschlüsse auf die Ereignisse ziehen, die wahrscheinlich ihre Migration ausgelöst haben. Dieses Wissen könnte Naturschützern helfen, einige der Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen – nicht nur auf die Insekten selbst, sondern auch auf ihre Wanderungen und die Ökosysteme, in denen sie leben.
Viele Insekten verbringen ihr ganzes Leben an einem Ort. Viele andere ziehen, wie viele Vögel, um rauem Wetter zu entgehen, Nahrung zu finden oder sich zu vermehren. Schätzungen zufolge wandern jedes Jahr Billionen von Insekten rund um den Globus, doch Wissenschaftler wissen kaum, wohin sie ziehen und wie sie dorthin gelangen.
Die Verfolgung von Insektenwanderungen ist nicht so einfach wie die von Vögeln oder Säugetieren. Bei Vögeln „kann man einen Ring am Bein befestigen oder per Funk orten, und schon lässt sich leicht nachweisen, dass sie sich von Punkt A nach B bewegen“, sagt Tomasz Suchan, Molekularökologe an der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Krakau. Die meisten Insekten sind jedoch zu klein, als dass diese Techniken erfolgreich wären.
In Nordamerika konnten Forscher einige Erfolge bei der Beobachtung von Monarchfaltern verzeichnen , die für ihre bemerkenswerte Migration von Südkanada und Nordamerika nach Zentralmexiko bekannt sind. Anfang der 1990er Jahre begann die Bürgerinitiative Monarch Watch damit, Schmetterlinge rund um die Rocky Mountains zu markieren. Über zwei Millionen Monarchfalter wurden markiert, und in Mexiko, wo sich die Falter zum Überwintern versammeln, wurden über 19.000 Funde gemeldet. Dies hat Biologen geholfen, ihre Migrationsrouten zu verfolgen.
Schmetterlinge ohne solche klar definierten Ansammlungen sind jedoch schwieriger zu verfolgen. Beispielsweise tauchen Distelfalter im Herbst häufig in Europa auf, manchmal in großer Zahl. „Dann verschwinden sie, und wir wissen nicht wirklich, wohin sie gehen“, sagt Gerard Talavera, Entomologe am Institut Botànic de Barcelona.
Vor einigen Jahren entdeckten Talavera und sein Team, dass sie die Schmetterlinge möglicherweise indirekt verfolgen könnten, indem sie den Pollen untersuchten, der sich auf ihren Körpern ansammelt. Jedes Mal, wenn ein Schmetterling eine Blüte besucht, um Nektar zu trinken, nimmt er auch Pollenkörner auf. Wenn die Forscher Pflanzen anhand ihres Pollens identifizieren, feststellen könnten, wo und wann sie blühten, und sie weiterverfolgen könnten, während die Schmetterlinge verschiedene geografische Regionen erreichten, könnten sie möglicherweise die gesamte Reise der Schmetterlinge nachvollziehen. „Die Methode ist, als würden wir sie mit einem GPS ausstatten“, sagt Talavera. „Da wir das nicht können, kommen wir dem am nächsten.“
Pollenwanderungskarten
Die Wissenschaftler konnten die Idee 2019 testen, als die Population der Distelfalter einen sporadischen Boom erlebte. Im März desselben Jahres, als Schwärme der Schmetterlinge im Nahen Osten und im Mittelmeerraum auftauchten, sammelten die Bürgerwissenschaftler Schmetterlingsproben, konservierten sie in einer Alkoholmischung und schickten sie an Talaveras Labor.
Dort isolierten die Forscher die an den Körpern der Schmetterlinge haftenden Pollenkörner und sequenzierten einen bestimmten Abschnitt der Pollen-DNA, der für jede Pflanzenart eine einzigartige Signatur aufweist – ein Prozess, der als Metabarcoding bezeichnet wird. Gleichzeitig sammelten Bürgerwissenschaftler weiterhin Schmetterlingsproben, während sich die Population in den folgenden Monaten allmählich in Ost-, Nord- und Westeuropa ausbreitete und Anfang November Südmarokko erreichte.
Die Forscher analysierten Pollen von 264 Schmetterlingen aus zehn verschiedenen Ländern, die sie sieben Monate lang gesammelt hatten, und identifizierten 398 verschiedene Pflanzen, anhand derer sie die Wanderungen der Schmetterlinge im Laufe des Jahres zurückverfolgen konnten. Sie fanden heraus, dass die in Russland, Skandinavien und den baltischen Ländern beobachteten Schmetterlingsschwärme wahrscheinlich Nachkommen von Schmetterlingen waren, die aus der Ausbreitung in Arabien und dem Nahen Osten stammten. Diese Ausbreitung scheint sich nach Osteuropa, dann nach Skandinavien und schließlich nach Westeuropa ausgebreitet zu haben, was zu einem deutlichen Populationsboom in Großbritannien, Frankreich und Spanien führte. Von dort wanderten die Schmetterlinge möglicherweise nach Südmarokko und weiter nach tropischem Afrika, um dort ihren Jahreszyklus zu vollenden.
Die Pollendaten lieferten sogar einen Hinweis darauf, warum Distelfalter 2019 plötzlich so zahlreich waren. Schmetterlinge, die gleich zu Beginn des Populationsschubs im östlichen Mittelmeerraum gesammelt wurden, trugen Pollen von Pflanzenarten in sich, die vor allem in halbtrockenen Buschlandschaften, Graslandschaften und Salzwiesen Nordarabiens und des Nahen Ostens vorkommen. Bei der Untersuchung von Satellitenbildern stellten die Forscher fest, dass diese Pflanzen von Dezember 2018 bis April 2019 nach einer Periode ungewöhnlich starker Regenfälle einen starken Wachstumsschub erlebten. Dieser Wachstumsschub, so spekulieren die Forscher, könnte den Schmetterlingen ideale Bedingungen zum Fressen und Brüten geboten haben, was die Populationsexplosion auslöste und einen Dominoeffekt hinterließ, der viele Generationen beeinflusste.
Talavera und sein Team nutzten Pollensignaturen, um auch die Bewegungen anderer Schmetterlinge zu verfolgen. 2013 wurden beispielsweise ruhende Distelfalter an der Küste Südamerikas in Französisch-Guayana gefunden. Distelfalter leben normalerweise nicht in Südamerika, und ihre Herkunft war ein Rätsel. Zehn Jahre später entnahm Talaveras Team Pollenproben von den noch erhaltenen Schmetterlingskörpern und stellte fest, dass die mit Abstand am häufigsten an diesen Schmetterlingen haftende Pollenart Guiera senegalensis , eine nur in Afrika südlich der Sahara vorkommende Pflanze, war.
Durch die Analyse von Küstenuntersuchungen, Windmustern, Pollen und Umweltbedingungen bestätigten sie, dass die Schmetterlinge den Atlantik wahrscheinlich in einem bis zu achttägigen Flug von Afrika aus überquerten. Dieser Befund war der erste nachgewiesene Fall einer Atlantiküberquerung durch ein Insekt .
„Die Verwendung von Pollen-Metabarcoding, um zu verfolgen, woher jede Schmetterlingsgeneration stammt und wie sie sich durch den Zyklus entwickelt, ist völlig neuartig“, sagt Christine Merlin, Biologin an der Texas A&M University und Co-Autorin eines Artikels über die Neurobiologie der Schmetterlingswanderung im Annual Review of Entomology . Da sie einzelne Pflanzenarten identifiziert, verspricht diese Methode eine höhere Präzision als die Standardmethode, die Isotopensignaturanalyse, die regionale Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der Insekten verfolgt.
Während Distelfalter als Modellsystem zum Verständnis der Insektenwanderung dienen, sind die Forscher zuversichtlich, dass diese Methode auch für die Verfolgung anderer wandernder Bestäuber geeignet sein könnte, die aktiv Blüten aufsuchen, um Nektar zu sammeln, darunter andere Schmetterlinge, Schwebfliegen, Wespen, Käfer und Motten.
Die Verfolgung von Insektenwanderungen könnte angesichts des Klimawandels an Bedeutung gewinnen, da Insekten neben Pollen auch Pilzkrankheiten übertragen können. Suchan entdeckte in einigen Schmetterlingen zahlreiche Pilzarten. Etwa 1.000 Pilzarten sind bekannt, die Insekten befallen, und über 19.000 können Nutzpflanzen schädigen. Daher könnten wandernde Insekten diese Pilzkrankheiten potenziell über Kontinente verbreiten und so Ökosysteme und Volkswirtschaften gefährden. Talavera, Suchan und ihre Kollegen hoffen, dass die Nutzung von Pollensignaturen zur Kartierung veränderter Migrationsmuster dazu beitragen könnte, mögliche Ausbrüche von Pilzkrankheiten vorherzusagen.
Cuvelier hofft unterdessen, weiterhin mit seiner Enkelin Schmetterlinge zählen zu können. Ökologen würden zunehmend mehr „Big Data“ benötigen, um großräumige Phänomene zu verstehen, sagt er. Ohne Bürgerwissenschaftler, so Cuvelier, „ist es für Forscher unmöglich, solche Datenbanken aufzubauen.“
Außerdem, fügt er hinzu, können junge Menschen durch Citizen Science mehr lernen als nur, wie man einen Schmetterling fängt. „Sie lernen etwas über die Natur“, sagt er, „und das fördert ihre Neugier auf die Welt.“
Foto: Debadutta auf Pexels